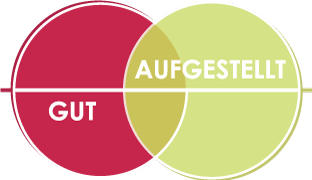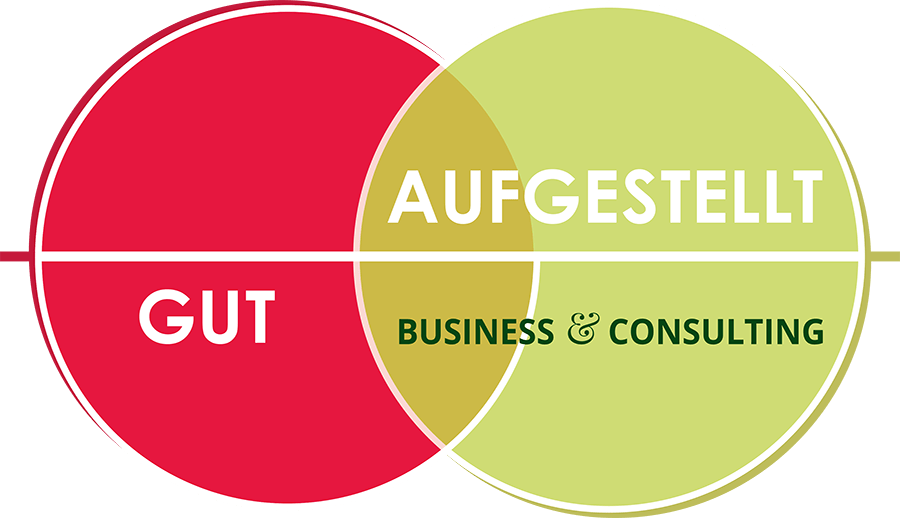Sprache wirkt wortwörtlich, unabhängig davon, ob das gewollt ist, oder nicht. Das gilt für das gesprochene Wort genauso wie für jeden Gedanken.
So ist die Formulierung “Ab morgen rauche ich nicht mehr” eine besonders sichere Methode, weiterhin täglich zur Zigarette zu greifen. Das hängt mit zwei Eigenschaften des Gehirns zusammen:
- Negationen bleiben unberücksichtigt. Daher ist es auch nicht möglich, NICHT an den berühmten rosa Elefanten zu denken, wenn von diesem die Rede ist.
- Die neuronalen Verbindungen wachsen, wenn sie häufig genutzt werden. Der Satz “Ab morgen rauche ich nicht mehr” wirkt als die Selbst-Programmierung: “Ab morgen rauche ich mehr”. Und jede Wiederholung des Vorsatzes verstärkt den Rauchimpuls.
Wenig hilfreich wirkt auch der Vorsatz, eine bestimmte Anzahl Kilos verlieren zu wollen. Denn jeder neuerliche Gedanke “X Kilos weniger” erinnert an das Unerwünschte – die Kilos zu viel. Damit rückt der Misserfolg (das Übergewicht) in den Mittelpunkt und die Plastizität des Gehirns verstärkt das neuronale Netzwerk, in dem das Thema Übergewicht gespeichert ist. Förderlich ist dagegen, an das Zielgewicht zu denken. Wiederholungen erhöhen die Präsenz des Gewünschten, mit jedem noch so kleinen Erfolg steigt die Anziehungskraft der angestrebten Zukunft. Im Scheinwerfer dieser Aufmerksamkeit finden sich mehr und mehr Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen bzw. es leichter zu erreichen.
Negationen sind notwendig, um Unterschiede auszudrücken. Als Aufträge an uns selbst oder andere sind sie ungeeignet, häufig bewirken sie sogar das Gegenteil des Gewünschten.
Vielen fällt es leichter, über das zu reden, was sie nicht wollen. Damit richten sie die Aufmerksamkeit auf das Unerwünschte und beginnen unbewusst, sogar danach zu suchen. Dann ist Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer, der im Alltag ständig Ausschau nach dem hält, was man vermeiden will.
In Organisationen wird seit vielen Jahren abteilungsübergreifend Zusammenarbeit gefordert – mit meist bescheidenem Erfolg, was unter anderem daran liegt, dass sprachlich das genaue Gegenteil gefördert wird. Denn jedes Mal, wenn die Bezeichnung “Abteilung” fällt, regt diese das Gehirn an, sich als Einheit oder Team abzuteilen. Genauso nachteilig wirkt der Begriff “Schnittstellen”. Was gut gemeint dazu führen soll, dass Prozesse möglichst in Bewegung bleiben, fordert zum Schnitt und damit Stillstand auf. Die Bezeichnung “Nahtstelle”, für die ich seit Jahren eintrete, fokussiert auf die Qualitäten, die bei Arbeitsübergaben wesentlich sind: Besondere Haltbarkeit und Flexibilität.
Ein im alltäglichen Sprachgebrauch häufig genutztes Wort ist „müssen“. Unabhängig von der Frage, ob wir etwas wirklich müssen gilt es auch hier, auf die Wirkung zu achten. Dieser Ausdruck ist negativ besetzt, er wird assoziiert mit unerwünschter Pflicht, Einschränkung, Fremdbestimmung. Wer etwas muss, fühlt sich eher klein. Das ist kaum die optimale Voraussetzung für Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Eine Formulierung mit positiven Nebenwirkungen könnte lauten: „Ich tue es, weil ich mich dazu entschieden habe.“ Das könnte nebenbei dem eigentlichen Grund dafür, dass wir etwas tun, sehr nahe kommen.
Zum Abschluss mein persönliches Unwort des Jahrzehnts: Work-Life-Balance.
Es vermittelt, dass es entweder Arbeit gibt oder ein Leben und bewirkt so das Gegenteil von dem, was damit gemeint ist. Nimmt man es wortwörtlich, könnte man sich vorstellen, dass Werktätige lebend bis ans Firmentor kommen, dort in einen komaähnlichen Zustand fallen, in dem sie den Arbeitstag verbringen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes wieder lebendig werden. Einfach absurd, diese Bezeichnung.
Was sind ihre Lieblingswörter – und welche Wirkung haben sie?